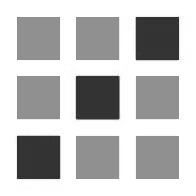Gemeinsame Kündigung von Schulverträgen
0 CommentsOLG Nürnberg zur Verpflichtung zur gemeinsamen Kündigung von Schulverträgen: Praxisrelevante Entscheidung für getrenntlebende Eltern
1. Einleitung: Wenn Eltern sich nicht einig sind – was passiert mit den Schulverträgen der Kinder?
Viele Eltern, die sich trennen oder bereits getrennt haben, stehen vor schwierigen Entscheidungen, die das gemeinsame Sorgerecht betreffen. Neben Fragen zum Umgang, Unterhalt oder Aufenthaltsbestimmungsrecht kann auch die schulische Situation der Kinder eine zentrale Rolle spielen. Besonders, wenn beide Elternteile gemeinsam Schulverträge geschlossen haben und sich über die Fortführung der Schulzugehörigkeit uneinig sind, geraten juristische Fragen in den Fokus. Kürzlich hatte das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg einen solchen Fall zu entscheiden, der Klarheit in einem bislang wenig beleuchteten Bereich schafft.
2. Der Sachverhalt: Streit um die Kündigung von Schulverträgen
Im vorliegenden Fall war die Ehe der Eltern geschieden. Beide sorgeberechtigten Elternteile hatten für ihre gemeinsamen Kinder Schulverträge bei einer bestimmten Schule abgeschlossen. Nach der Trennung kam es zum Zerwürfnis über die weitere Bildungsplanung: Die Kindesmutter – die Antragstellerin – wollte erreichen, dass die bestehenden Schulverträge im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt werden. Dies wurde von dem Kindesvater, dem Antragsgegner, verweigert.
Die Antragstellerin beantragte daher gerichtlich, den Antragsgegner zu verpflichten, gemeinsam mit ihr die Schulverträge der gemeinsamen Kinder zu kündigen. Das Amtsgericht Regensburg wies den Antrag zurück. Dagegen legte die Antragstellerin Beschwerde zum OLG Nürnberg ein.
3. Die Entscheidung des OLG Nürnberg
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat mit Beschluss vom 10.04.2025 (Az.: 10 UF 1180/24) die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen. Die Antragstellerin muss somit nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen, sondern erhält auch keine Verpflichtung des anderen Elternteils zur Mitwirkung an der Vertragskündigung.
Rechtsgrundlagen dieses Verfahrens waren § 1628 BGB (Übertragung der Entscheidung auf einen Elternteil bei Meinungsverschiedenheiten im Bereich der elterlichen Sorge) und § 1631 BGB (Inhalt und Grenzen der elterlichen Sorge).
4. Begründung: Warum entschied das OLG Nürnberg so?
Das OLG führt aus, dass der Antrag auf gemeinsame Kündigung der Schulverträge als Teil der Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts zu werten ist. Eine gerichtliche Verpflichtung eines Elternteils zur Mitwirkung an solch einer konkreten Willenserklärung ist jedoch eine Ausnahme und bedarf strenger Voraussetzungen. Im Idealfall einigen sich die Eltern außergerichtlich. Das Gericht konnte keine ausreichende rechtliche Grundlage erkennen, um unter den gegebenen Umständen die Mitwirkung an der Kündigung zu erzwingen.
Weiterhin bleibt zu berücksichtigen, dass im Rahmen der elterlichen Sorge wesentliche Entscheidungen – zu denen bei streitigen schulischen Belangen auch die Wahl oder der Verbleib an einer bestimmten Schule zählt – im Grundsatz gemeinsam zu treffen sind. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Familiengericht zwar einzelne Entscheidungen einem Elternteil allein übertragen kann, aber nicht, dass das Gericht Verpflichtungen zu gemeinsamen Willenserklärungen aktiv herbeiführt, solange keine wesentlichen Kindeswohlbelange Gefahr laufen oder andere schwerwiegende Gründe eine gerichtliche Intervention rechtfertigen.
Im konkreten Fall lag aus Sicht des Gerichts keine ausreichende Grundlage für eine solche Anordnung vor. Die Eltern bleiben auch nach ihrer Trennung verpflichtet, sich in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung – wie eben der Kündigung von Schulverträgen – um Einigkeit zu bemühen.
5. Relevanz für die Praxis: Auswirkungen auf zukünftige gerichtliche Verfahren
Diese Entscheidung setzt für die familiengerichtliche Praxis einen wichtigen Akzent: Gerichtliche Verpflichtungen zur gemeinsamen Abgabe von Willenserklärungen werden restriktiv gehandhabt. Es bleibt im Regelfall bei der Pflicht zur gemeinsamen Sorgerechtsausübung – die Gerichte greifen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen ein.
Für Antragsteller bedeutet das: Gerichtliche Verfahren auf Verpflichtung zur gemeinsamen Handlung werden – gerade bei Schulverträgen – regelmäßig abgelehnt, sofern keine (vom Gesetz vorgesehene) Kindeswohlgefährdung oder andere erhebliche Gründe vorliegen. Streitigkeiten auf diesem Feld drehen sich künftig wohl mehr um die Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil gem. § 1628 BGB als um eine gerichtliche Verpflichtung zum „gemeinsamen Handeln“.
6. Praxistipps und Handlungsempfehlungen für Eltern
- Den außergerichtlichen Dialog suchen: Bevor es zu gerichtlichen Eskalationen kommt, empfiehlt es sich stets, das Gespräch zu suchen und gegebenenfalls externe (z.B. schulische oder psychologische) Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen.
- Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen: Die Entscheidung über die Kündigung eines Schulvertrags betrifft in der Regel das Wohl des Kindes in erheblicher Weise. Wer gerichtlichen Bestand will, muss darlegen, warum die Änderung oder Beendigung der schulischen Bindung im Interesse des Kindes liegt.
- Antrag nach § 1628 BGB prüfen: Ist eine einvernehmliche Lösung unmöglich, sollte geprüft werden, ob nicht besser die Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil (und nicht die Verpflichtung zur gemeinsamen Handlung) beantragt werden sollte. Dies wird von den Gerichten regelmäßig als geeigneter Weg angesehen.
- Wirksame Anträge formulieren: Wer vor Gericht zieht, sollte den Antrag so gestalten, dass das Gericht klar und eindeutig – notfalls durch Übertragung des Entscheidungsrechts – entscheiden kann.
- Rechtzeitig anwaltliche Beratung einholen: Das Sorgerecht ist ein sensibles Thema, das erhebliche Auswirkungen auf das Kindeswohl und die Eltern-Kind-Beziehung haben kann. Frühzeitige Beratung erspart Kosten, Zeit und mögliche emotionale Verletzungen.
- Kostenrisiko bedenken: Abgewiesene Anträge haben neben emotionalen Belastungen auch finanzielle Folgen: Die Antragstellerin musste im vorliegenden Verfahren sämtliche Kosten tragen.
7. Fazit: Keine Verpflichtung zur gemeinsamen Kündigung auf gerichtlichem Weg
Das OLG Nürnberg macht unmissverständlich klar, dass gerichtliche Verpflichtungen zur gemeinsamen Willenserklärung (wie der Kündigung von Schulverträgen) restriktiv zu behandeln sind. Eltern sind angehalten, ihre Sorgerechtskompromisse eigeninitiativ zu suchen. Nur wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet ist, oder sich schwerwiegende Gründe ergeben, kann das Gericht eingreifen – und zwar meist durch Übertragung der Entscheidung, nicht durch Verpflichtung zur gemeinsamen Handlung. In der anwaltlichen Beratung sollte dieser Weg frühzeitig aufgezeigt werden. Prozessuale Klarheit und der Fokus auf außergerichtliche Lösungen schützen die Beteiligten – vor allem aber die Kinder.